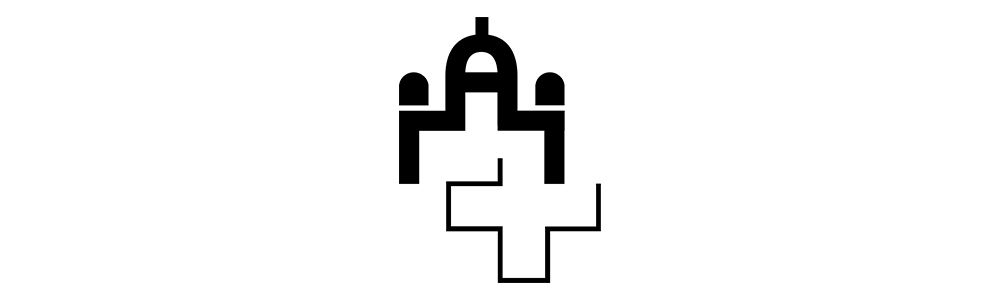Die demografische Entwicklung mit dem immer grösser werdenden Anteil älterer Menschen, von denen viele an mehreren chronischen Erkrankungen leiden, ist eine grosse Herausforderung. Auch die immer früheren Entlassungen der Patientinnen und Patienten nach einem Spitalaufenthalt erfordern häufig Pflegebetreuung zu Hause. Die Pflege wird dadurch mengen- und qualitätsmässig anspruchsvoller.
Die Pflege ist ein wichtiger Bestandteil der Gesundheitsversorgung und für eine optimale Behandlung unerlässlich. Sie ist für den einzelnen Patienten aus medizinischer und auch ganz persönlicher Sicht entscheidend.
So erstaunt es nicht, dass in kurzer Zeit die Volksinitiative „für eine starke Pflege“ zustande gekommen ist. Wer will schon nicht eine starke Pflege? Dieses Anliegen soll in der Bundesverfassung verankert werden.
Allerdings: Mit Artikel 117a, „Medizinische Grundversorgung“, besteht bereits ein entsprechender Verfassungsartikel, der die Pflege umfasst und damit ausreicht, um die Pflege zu stärken. Diese Information wurde vermutlich von den Initianten tunlichst verschwiegen.
Zudem hat der Bund im Rahmen seiner Kompetenzen auch bereits zahlreiche Massnahmen für die Verbesserung der Situation in der Pflege in die Wege geleitet. Mit dem Massnahmenplan sind weitere wirksame Projekte umsetzungsbereit.
Von Pflegenotstand zu sprechen, ist nach den gebetsmühlenartigen Wiederholungen des sogenannten Klimanotstandes sehr eingängig, aber nicht wahrheitsgetreu. Vergleicht man das Angebot an Pflegepersonal in der Schweiz mit anderen OECD-Ländern, so kann man kaum von einem Mangel sprechen. Betrachtet man die Zahl der diplomierten Pflegefachpersonen, steht die Schweiz mit 17 Pflegefachpersonen pro 1000 Einwohner an erster Stelle. Im Gegensatz dazu hat die Schweiz nur 7,7 Pflegehelfer pro 1000 Einwohner und liegt damit auf Platz 9. Dies ist jedoch ein anderes Problem, auf das ich später noch eingehen werde.
Die Ausbildung im Gesundheitswesen ist eines der erfolgreichsten Studiengebiete. Der kürzlich erschienene Schlussbericht des Bundesrates zum Masterplan Bildung Pflegeberufe zeigt, dass sich die Zahl der Abschlüsse im Beruf Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ zwischen 2007 und 2014 mehr als verdoppelt hat. Mit 83,6 Absolventen pro 100 000 Einwohner, alle Bildungsebenen berücksichtigt, liegt die Schweiz weit vor den anderen Ländern. Der Durchschnitt der OECD-Länder liegt bei 47 Absolventen, nicht bei 83.
Die Pflege-Initiative und, etwas abgeschwächt, auch der indirekte Gegenvorschlag riskieren jedoch einen enormen Kostenschub und damit einen Blindflug in Richtung Prämienschub.
Die Forderung der Initiantinnen und Initianten, dass Pflegefachpersonen Pflegeleistungen in eigener Verantwortung abrechnen können sollen, würde mit grösster Wahrscheinlichkeit zu einer Mengenausweitung und damit zu beträchtlichen Mehrkosten zulasten der Grundversicherung, der Kantone, des Bundeshaushalts und schlussendlich der Prämienzahler führen.
Laut dem erläuternden Bericht werden die Mehrkosten für den Pflegeheimbereich auf 30 Millionen Franken pro Jahr und für die häusliche Pflege auf 25 bis 110 Millionen Franken pro Jahr geschätzt. Auch, und das ist sehr entscheidend, würde ein Präjudiz für andere Berufsgattungen im medizinischen Bereich geschaffen, die verständlicherweise die gleichen Rechte einfordern könnten. Das heisst, es würde eine weitere Kostenlawine ohne echte Leistungsverbesserung ausgelöst, und das zu einem Zeitpunkt, in welchem die stetig steigenden Gesundheitskosten mit einem ganzen Massnahmenpaket bekämpft werden sollen und alle anderen Player im Gesundheitsbereich gefordert sind, Einsparungen zu erzielen.
Mit der Volksinitiative sollen zudem arbeitsrechtliche, vielleicht sogar berechtigte Forderungen wie bessere Arbeitsbedingungen für das Personal erzwungen werden. Diese sind jedoch auf Verfassungsstufe am falschen Ort. Vielmehr muss das eigentliche Ziel, dass die Pflegebedürftigen eine angemessene Behandlung in den Institutionen erhalten, gelöst werden, denn eines ist klar: Eine ungenügende Pflege führt oft zu Folgekosten im teuren stationären Bereich.
Aber ebenso müssen die Prämienzahlenden davor geschützt werden, dass auch noch im Pflegebereich Überversorgung und ungebremste Mengenausweitung Einzug halten, wie sie bereits in vielen anderen Gesundheitsbereichen das Kostenwachstum ohne adäquaten Mehrwert befeuern. Nicht zuletzt haben die Patienten, die einen grossen Teil der Pflegekosten selber tragen, ein Anrecht darauf, dass sie für ihr Geld Leistungen erhalten und nicht ineffiziente Strukturen subventionieren, die zu unattraktiven Arbeitsbedingungen des Personals beitragen.
Die SVP-Fraktion bittet Sie deshalb, die Volksinitiative zur Ablehnung zu empfehlen und auch nicht auf den indirekten Gegenvorschlag einzutreten.
Jetzt komme ich zu meinem Minderheitsantrag auf Nichteintreten auf die Bundesbeschlüsse 2 sowie 3 und 4.
Nochmals: Eine weitere Förderung der Ausbildung im Bereich Pflege ist zweifellos notwendig, um der steigenden Nachfrage nach Pflegeleistungen begegnen zu können. Allerdings muss diese Förderung bedarfsgerecht erfolgen, d. h. in den Bereichen, wo tatsächlich Not am Mann, respektive an der Frau ist. Eine weiter gehende Akademisierung der Pflegeberufe ist wenig hilfreich.
Viel entscheidender als Finanzhilfen und vor allem viel problematischer ist es, die geeigneten Menschen zu finden, die bereit sind, diesen sehr schönen, aber psychisch und körperlich auch sehr strengen Beruf auszuüben, unregelmässige Arbeitszeiten in Kauf zu nehmen und mit kranken oder betagten Menschen zu arbeiten. Das Profil für Pflegefachpersonen ist äusserst anspruchsvoll. Nebst Wissen und fachlichem Können sind viel Empathie, Einfühlungsvermögen und eine hohe Sozialkompetenz gefragt. Vor allem in Alters- und Pflegeheimen braucht es auch generationenübergreifendes Verständnis, das heisst, es braucht Leute, die den Kontakt mit älteren Leuten mögen.
Es existiert nun mal einfach nur ein bestimmter Pool von Menschen, die diese Eigenschaften mitbringen, die bereit sind, auch unangenehmere und strengere Arbeiten pragmatisch auszuführen und sich mit viel Herzblut und Liebe für die Patientinnen und Patienten oder die Bewohnerinnen und Bewohner eines Pflege- oder Altersheims einzusetzen. Ich habe hohe Achtung vor dieser Berufsgattung. Deshalb befürwortet die SVP-Fraktion auch Erleichterungen beim Wiedereinstieg in den Pflegeberuf und die Anerkennung früherer Abschlüsse, um z. B. Mütter oder Väter nach einer Familienarbeitszeit wieder für diese wichtigen Berufe zu motivieren.
Auch ohne diese Initiative oder den indirekten Gegenvorschlag ist übrigens im Auftrag des Bundesrates geplant, die Kosten für Wiedereinstiegskurse von 2018 bis 2022 durch Bund und Kantone zu übernehmen und damit zweitausend diplomierte Pflegefachkräfte zur Wiederaufnahme einer Pflegetätigkeit zu gewinnen. Die Kosten pro Kurs belaufen sich auf 2000 bis 5000 Franken pro Person. Doch muss man sich immer bewusst sein, dass nur Personal, das das Leistungsprofil optimal erfüllt – und dazu gehören auch Herzblut und Empathie -, langfristig den erwünschten Nutzen bringen kann.
Finanzielle Anreize bergen leider auch die Gefahr, nicht geeignete Personen zu motivieren, was wiederum zu sinkender Pflegequalität führen und die Gesundheits- und Prämienkosten weiter steigen lässt.
Die SVP-Fraktion findet es aber auch grundsätzlich fragwürdig, für eine einzelne Berufsgattung weitere Ausbildungsbeiträge an die Kantone auszurichten. Denn auch in vielen anderen Berufssparten, zum Beispiel bei den Ingenieuren oder eben auch in Berufen, in denen strenge körperliche Arbeit gefordert wird, besteht Fachkräftemangel. Ich denke an die Baubranche, die Landschaftsgärtner oder auch an die Gastronomie. Wo körperliche Arbeit zu nicht immer angenehmen Bedingungen gefordert ist, haben auch andere Berufsbranchen zu kämpfen.
Zudem greifen die Vorschriften zum einen bezüglich der Bereitstellung und Finanzierung von Ausbildungsplätzen in die kantonale Autonomie ein und stehen damit im Widerspruch zu den verfassungsrechtlichen Prinzipien der Subsidiarität und der fiskalischen Äquivalenz. Zum andern führen sie für den Bund zu hohen Kosten in einem Bereich, wo die Kantone und die Branchen zuständig sind.
Die SVP-Fraktion beantragt aus genannten Gründen, weder auf den Bundesbeschluss über Finanzhilfen zur Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege, noch auf den Bundesbeschluss über die Erhöhung der Ausbildungsabschlüsse in Pflege an den kantonalen Fachhochschulen und auch nicht auf den Bundesbeschluss über Finanzhilfen zur Förderung der Effizienz in der medizinischen Grundversorgung, insbesondere der Interprofessionalität, einzutreten. Interprofessionalität und Effizienz sollten in jedem Betrieb und auch in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Playern eine Selbstverständlichkeit sein. Mit diesen Beschlüssen werden die wirklichen Probleme nicht gelöst, und wie schon erwähnt, wurden von Bund und Kantonen verschiedenste Massnahmen eingeleitet.
Die SVP-Fraktion bittet Sie deshalb, den Nichteintretensantrag zu unterstützen und ebenfalls, die Bundesbeschlüsse nicht anzunehmen.
Zur Chronologie der Debatte
Zum Video der Debatte